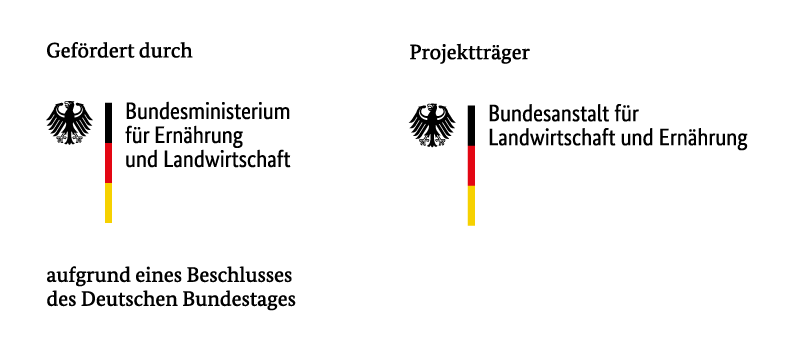Bienen haben keinen Kalender, sondern sind in ihrem Lebenszyklus von den Temperaturen rund um den Stock und im gesamten Futtergebiet abhängig. So haben Autoren die Relevanz der Phänologie – also die Beobachtung z.B. des Blühbeginns von Zeigerpflanzen – für Hongibienen erkannt (Ritter 2020). Pflanzen haben auch keinen Kalender, viele Pflanzen blühen in Abhängigkeit des Temperaturgeschehens im Jahr. Landwirte machen sich das zu Nutze und verwenden z.B. die Grünlandtemperatursumme. Dieser Beitrag beleuchtet den Zusammengang zwischen der Grünlandtemperatursumme und dem phänologischen Kalender sowie den möglichen Zusammenhängen mit dem Verhalten von Honigbienen – und wie Imker letztendlich davon abhängig sind.
Stand 02.03.2024
Bienen haben keinen Kalender
Die üblichen Monatsbetrachtungen und ältere Fachbücher mit Titeln wie „Imkern im Jahresverlauf“ versuchen, Orientierung durch Handlungsempfehlungen „nach Kalender“ zu geben. Das hilft nur begrenzt, jedes Jahr ist anders und Bienen haben ja nach Jahresverlauf und auch standortspezifisch unterschiedliche Zeiten, in denen sie bestimmtes verhalten zeigen oder auch Bedarfe haben.
Phänologische Jahreszeiten
Die Beobachtung der Erscheinungen in der Natur wie etwa der Blühbeginn von Zeigerpflanzen können auch in der Imkerei helfen. So gibt es Faustregeln, erst nach Beginn der Salweidenblüte die Völker durchzuschauen. Bienen reagieren auf die Blüte der Hasel, die der erste Pollenlieferant im Jahr ist. Auch die Landwirtschaft aufbeitet nach den phänologischen Erscheinungen. Die Phänologie gliedert das Jahr nicht in vier, sondern in zehn Jahreszeiten. Jede Jahreszeit wird durch eine bestimmte Beobachtung eingeleitet. So beginnt der Erstfrühling mit der Blüte der Forsythie.
Der Deutsche Wetterdienst stellt Daten zu den Phänologischen Jahreszeiten in Form einer Uhr zur Verfügung (Abb. 1). Zur Erstellung hat der Deutsche Wetterdienst viele Helfer, die durch Blühmeldungen zur wöchentlichen Aktualisierung der Uhr beitragen.
Abb. 1: Der Pänologische Kalender, eine aktuelle farbige Darstellung aktualisiert der Deutsche Wetterdienst mit der Phänologischen Uhr jeden Dienstag. Der Temperaturverlauf im Jahr hat einen großen Einfluss darauf, wann Pflanzen blühen und damit auf die phänologischen Jahreszeiten. Der Zusammenhang zum Kalender wird durch zwei besondere Tage im Jahr hergestellt: Der Sommersonnenwende am 21. Juni und der Wintersonnenwende am 21. oder 22. Dezember.
Der Phänologische Kalender und die Imkerei
Der Blühbeginn der Pflanzen bildet die Grundlage für die Volksentwicklung bei den Bienen. Im Vorfrühling steht den Bienen mit der Hasel die erste Pollenquelle zur Verfügung, im Vollfrühling gibt es die ersten großen Trachten. Damit ist auch die Imkerei letztendlich durch die Phänologie gesteuert. Abb. 2 versucht das in einer tabellenähnlichen Darstellung zu fassen. Die Basis ist hier die phänologische Jahreszeit (unten im Bild), die (ein wenig) die Betriebsweise in der Imkerei steuert und auf die sich das imkerliche Handeln (oben im Bild) abstützt.
Abb. 2: Zusammenhang der Phänologischen Jahreszeiten mit dem Verhalten der Bienen und den Auswirkungen auf die Imkerei (nach Ritter 2021). Das Imkern nach den phänologischen Jahreszeiten wird in einer zehnteilgen Artikelserie in diesem Blog zusammengefasst, z.B. Phänologisch imkern im Erstfrühling
Phänologische Erscheinungen hängen vom Temperaturgeschehen ab
Woher wissen Forsythie und der Schwarze Holunder, wann es Zeit zum Blühen ist? Abb. 1 (rechts) zeigt vier Einflussgrößen auf den Zeitpunkt der phänologischen Erscheinungen. Viele Pflanzen brauchen für ihre Entwicklung eine gewisse Zeit bei einer Mindesttemperatur. Je höher die Temperatur dabei ist, desto schneller geht es. In der Landwirtschaft gibt es unterschiedliche Konzepte, die versuchen, hierzu Regeln aufzustellen und Handlungshinweise zu geben. Allen Konzepten ist gemein, dass sie Temperaturen betrachten und im Zeitverlauf aufsummieren. In Südtirol verwenden Obstbauern Temperaturstunden, in Deutschland ist – vor allem für die Bewirtschaftung von Gräsern – die Grünlandtemperatursumme gebräuchlich.
Grünlandtemperatursumme
Die Grünlandtemperatursumme (GTS) kann für einen Strandort und für jeden Tag im laufenden Jahr berechnet und in Gradtagen °Cd angegeben werden. Oft findet man zur Vereinfachung die Angabe Grad Celdius, was aus physikalischer Sicht nicht ganz korrekt ist. GTS steigt im Jahresverlauf kontinuierlich an.
Die Berechnung der Grünlandtempertursumme für einen Standort ist mathematisch einfach:
Jeden Tag wird für einen Standort die mittlere Tagestemperatur erfasst. Das kann mit einem digitalen Temperaturlogger erfolgen, wenn man nur Thermometer, Stift und Papier hat, gibt es auch dafür Berechnunsgmethoden.
Ist diese mittlere Tagestemperatur größer als Null, so wird sie zur GTS von gestern hinzuanddiert. Dabei wird sie mit einem Faktor gewichtet: Im Januar ist der Faktor=0,5. Im Februar ist der Faktor=0,75, in den restlichen Monaten ist der Faktor=1. Andere Pflanzen haben andere Temperatursummen, bei denen sie bestimmte phänologische Erscheinung zeigen. Einige sind in Tab. 1 aufgelistet.
Hat die so berechnete Grünlandtemperatursumme einen Wert von 200 °Cd erreicht, kann Dünger für z.B. Rasenflächen ausgebracht werden. Das Wachstum von Gräsern intensiviert sich.
| Grünlandtemperatursumme (GTS) | Pflanzenart |
| 35 – 70°Cd | Blüte Schneeglöckchen und Winterlinge |
| 65 – 120°Cd | Krokusblüte, Haselblüte, Winterjasmin |
| 175 – 230°Cd | Osterglocken klein, Forsythien |
| 175 – 260°Cd | Weidenkätzchen, frühblühende Kirschen |
| 275 – 300°Cd | Osterglocken, Austrieb Holunder |
| 335 – 380°Cd | Vorblüte Birke |
| ab 440°Cd | Vollblüte frühblühende Magnolien |
| 365 – 460°Cd | Vorblüte Kirsche |
| ab 530°Cd | Vollblüte Kirsche, Birke, Vorblüte Apfel |
| ab 540°Cd | Blattaustrieb Birke, Walnuss und Pappel |
| ab 550°Cd | Blattaustrieb Apfel, Kastanien Vollblüte |
| ab 550°Cd | Vollblüte Raps |
| ab 580°Cd | Vorblüte Flieder |
| ab 700°Cd | Apfel und Löwenzahn Vollblüte |
Tab. 1: Grünlandtempetratursummen und phänologische Erscheinungen. Die für die Imkerei relevanten phänologischen Erscheinungen sind fett gesetzt.
Zusammenhang zwischen Grünlandtemperatursummen, phänologischen Jahreszeiten und Bienen
Der Zusammenhang zwischen den Grünlandtemperatursummen, den Phänologischen Jahreszeiten, dem Verhalten der Bienen (vgl. Abb. 3) und letztlich die Auswirkungen der Grünlandtemperatursumme auf die imkerliche Betriebsweise lässt sich wie in Liste 1 beschreiben.
- Die Entwicklung der Grünlandtemperatursummen legt die Zeiten im Jahr fest, zu denen das Wachstum beginnt und für Bienen wichtige Pflanzen blühen.
- Bienen sind darauf angewiesen, dass sie Blühpflanzen für ihre Volksentwicklung zur Verfügung haben. Die Volksentwicklung der Honigbienen hängt somit zeitlich von phänologischen Erscheinungen und damit vom phänologischen Kalender ab. Damit die Bienen eine Tracht auch nutzen können, ist es erforderlich, dass sie mit der ausreichenden Personalstärke auftreten. Bereits vor der Blüte sollte sie daher das Brutgeschäft „vorausschauend“ intensiviert haben. Daraus kann man annehmen, dass Bienen – so wie Landwirte auch – einen Sinn für die Temperatursummen haben und somit zukünftige Blühereignisse prognostizieren können.
- Das Verhalten der Bienen und ihre Volksentwicklung legt die Zeitpunkte von imkerlichen Eingriffen fest und bestimmt die imkerliche Betriebsweise. Dabei sei vorausgesetzt, dass mit den Bienen und nicht gegen die Bienen geimkert wird.
- Mittelbar bestimmt so die Grünlandtemperatursumme die Zeitpunkte imkerlicher Eingriffe. Imker, die diese Zusammenhänge erkennen, können sich wiederum proaktiv zeitlich auf diese Zeitpunkte einstellen.
Liste 1: Zusammenhang zwischen den Grünlandtemperatursummen, den Phänologischen Jahreszeiten, dem Verhalten der Bienen und der imkerlichen Betriebsweise
Dabei helfen die vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellten Daten in Form der Phänologischen Uhr (vgl. Abb. 1) weiter, sind jedoch in der Aussagekraft für einen konkreten Standort begrenzt. Eine kleinräumigere Auswertung der Tagesmitteltemperaturen und Berechnung der Grünlandtemperatursummen wäre wünschenswert. Zur Frage der Größe der räumlichen Betrachtung hilft eine Einteilung nach Zacepins (2015), der Betrachtungsebenen Einzelbiene, Bienenstock, Bienenstand und Futtergebiet eines Bienenstandes definiert (vgl. Abb. 4). Da Bienen insbesondere in der Frühjahrsentwicklung mit dem Futtergebiet in Interaktion treten, bietet sich eine Granularität von Arealen mit einem Durchmesser von um die 10 km an.
Abb. 3: Von Temperatursummen über phänologische Erscheinungen zu Bienen
Abb. 4: Betrachtungsebenen auf die Imkerei nach Zacepins (2025). Rechts ist eine Kartenkachel dargestellt, die in etwa dem Futtergebier (4) entspricht.
Unterlagen für den Workshop zum Download
Der Workshop fand erstmalig am 01.03.2024 in Viersen statt.
Die Arbeitsblätter zum Workshop und ein Video stehen hier zum Download bereit:
Arbeitsblatt-Gruenlandtemperatursumme-Imkerei-Claus-Brell-240228
Arbeitsblatt-Phaenologischer-Kalender-Imkerei-Claus-Brell-240228
Quellen-zur-Phaenologie-und-Gruenladtemperatursummen-240227
Anhang
Quellen und Weiterlesen zu Grünlandtemperatursumme, Phänologischer Kalender und Bienen – Bedeutung der Temperatur für die Imkerei
Ritter, Wolfgang, Schneider-Ritter, Ute (2021) Das Bienenjahr – Imkern nach den 10 Jahreszeiten der Natur. 1. korrigierter Nachdruck. Hohenheim. Insbes. S. 24-43
Zacepins, A./Brusbardis, V./Meitalovs, J./Stalidzans, E. (2015): Challenges in the development of Precision Beekeeping, in: Biosystems Engineering Vol.
130, S. 60-71.
Das Biene40-Projekt zur Entwicklung vernetzter Sensoren im und am Bienenstock http://bieneviernull.de
Das Projekt zur Entwicklung eines KI-gestützten Bienenmonitorings AI4Bee https://ai4bee.de
Glossar
Phänologie
Das griechische Wort „phainein“ bedeutet „sichtbar machen“. Phänologie die Lehre vom Sichtbaren, also die Lehre von den Erscheinungen. Gemeint sind die Wachstums- und Entwicklungserscheinungen von Pflanzen und Tieren. Pflanzen sind leichter zu beobachten, daher fußen Kategorienesysteme wie der Phänologische Kalender auf der Beobachtung von Pflanzen: Charakteristischer Wachstumsstufen, zum Beispiel der Beginn der Blüte oder der Blattfall. Der Beginn der Phänologie liegt vermutlich im Jahr 705 in Japen bei der Beobachtung der Kirschblüte. In Deutschland wurde 1936 ein umfangreiches phänologisches Beobachtungsnetz aufgestellt.
Danksagung
Den Imkerkolleginnen und Imkerkollegen des Imkervereins Viersen Stadt danke ich für die Bereitschaft, sich immer kritisch mit unseren Ideen auseinanderzusetzen und auch als Citizen Scientists dem Projekt Biene40 zuzuarbeiten.
Die Auswarbeitung als Workshop – erstmalig durchgeführt am 01.03.2024 im Imkerverein Viersen Stadt – ist Teil des Projektes „Biene40 – vernetzte Sensoren für vitalere Bienen“. Biene40 ist eines von 16 geförderten Projekten (siehe Abb. Förderlogo), die unter der Vernetzungs- und Transfermaßnahme Beenovation zusammengefasst werden. Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Mit dem Förderaufruf „Bekanntmachung über die Förderung von Forschungsvorhaben zum Schutz von Bienen und weiteren Bestäuberinsekten in der Agrarlandschaft“ hat BMEL 16 Forschungsvorhaben, darunter „Biene40“, in drei Förderprogrammen eingeworben, die seit 2021 mit einem Fördervolumen von ca. 12. Mio. Euro umgesetzt werden. Die Vorhaben zielen auf die Entwicklung von innovativen und praxisorientierten Produkten und Verfahren für die Verbesserung der Widerstandskraft von Honigbienen, die Ermöglichung eines bestäuberfreundlichen Pflanzenbaus sowie die Entwicklung und Erprobung von Maßnahmen zur Förderung von Bienen und anderen Bestäuberinsekten in Agrarräumen. Die dazugehörige Vernetzungs- und Transfer Maßnahme „Beenovation“ verfolgt das Ziel, durch Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit eine hohe Sichtbarkeit und nachhaltige Breitenwirksamkeit der geförderten Verbundprojekte und der Fördermaßnahme sicherzustellen. Hierdurch werden sowohl der Wissensaustausch zwischen den verschiedenen beteiligten Stakeholdern aus Wissenschaft, Politik und Praxis, als auch die Innovationsprozesse der Verbundprojekte unterstützt und Synergien zu anderen Forschungsprojekten geschaffen.
Abb.: Förderlogo
Autor und Lizenz
Autor: Prof. Dr. rer. nat. Claus Brell, aktuelle Projekte: Biene40, AI4Bee
Lizenz: CC BY

Inhalte des Beitrages können Sie entsprechen der Lizenz verwenden. Unter dieser Lizenz veröffentlichte Werke darf jedermann für private, gewerbliche und sonstige Zwecke nutzen verändern und auch neu ohne CC-Lizenz vermarkten. Als Urheber mache ich keine Rechte geltend.